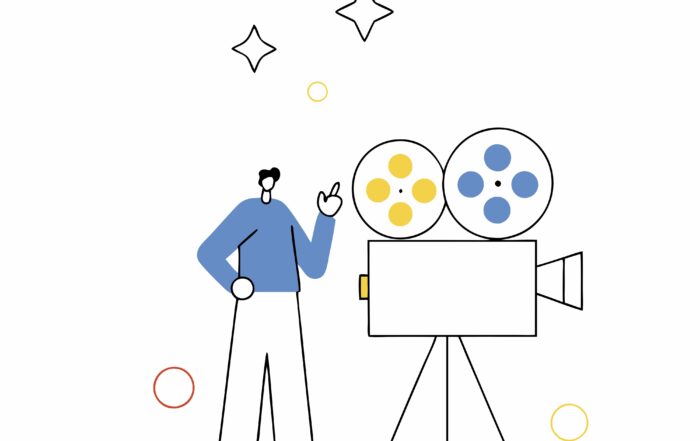„Mein Spiegelbild erscheint mir fremd.“ „Wenn ich spreche, scheint mir, als spräche ein anderer.“ „Der Garten wirkt farblos und stumpf.“ So oder ähnlich hören sich Schilderungen von Menschen mit einer Depersonalisations-Derealisationsstörung (kurz: DDS) an. Was für Außenstehende unvorstellbar klingt, bedeutet für Betroffene einen erheblichen Leidensdruck.
Studien weisen darauf hin, dass im westlichen Kulturkreis etwa 1 von 100 Personen an einer DDS erkrankt ist.[1] Damit wäre die Störung keinesfalls selten – dennoch ist sie vielen Mediziner*innen und Psycholog*innen nicht oder nur unzureichend bekannt und die Diagnose wird äußerst selten gestellt.[2] Ein Grund, die DDS näher vorzustellen.
Was ist eine Depersonalisations-Derealisationsstörung?
Charakteristisch für eine DDS ist, dass die Wahrnehmung des Selbst (= Depersonalisation) und/oder der Umwelt (= Derealisation) verändert ist.[3] Doch was bedeutet das?
Bei einer Depersonalisation erleben Menschen ihr eigenes Selbst als fremd, unwirklich, „nicht richtig da“ oder entfernt. Sie haben den Eindruck, nur Beobachter ihrer Gedanken, Gefühle oder Handlungen zu sein, oder der eigene Körper erscheint ihnen als nicht zu ihnen gehörig.[4] Für Erkrankte fühlt es sich etwa so an, als ob[5]
- ihre Gefühle oder Bewegungen jemand anderem gehören
- ihr Körper leblos oder losgelöst ist
- sie sich nicht in der Realität, sondern in einem Schauspiel befinden
- sie nicht wirklich da sind oder von der Welt abgeschnitten sind
- ihre eigene Stimme (oder die anderer Personen) unwirklich, fremd oder weiter entfernt ist
- ihre eigenen Bewegungen „automatenhaft“ und mechanisch sind (wie ein „Roboter“) und nicht zu ihnen gehören
- Dinge, die sie vor Kurzem getan haben, weit zurückliegen
Derealisation hingegen bedeutet, dass die Umwelt unwirklich, fremd, verzerrt oder entfernt erscheint. Für Betroffene wirken Dinge, Personen oder Umgebungen zum Beispiel[6]
- traumartig oder wie im Nebel
- verändert, z.B. in der Größe
- stumpf, leblos, eintönig, farblos
- künstlich; wie eine Kulisse
Die DDS beginnt meist in der Pubertät. Depersonalisation und/oder Derealisation kehren immer wieder oder halten lange an, teils über Jahre bis Jahrzehnte. Die Beschwerden können sehr plötzlich, aber auch schleichend einsetzen und in ihrer Intensität schwanken.[7]
Die DDS ist keine Psychose
Für Betroffene ist die veränderte Wahrnehmung sehr beängstigend. Sie befürchten etwa, an einem Hirnschaden zu leiden. Oder sie grübeln ständig darüber, ob sie tatsächlich existieren. Viele haben (zu Unrecht) Angst, „verrückt“ zu sein.[8]
In der Tat können Depersonalisations- und Derealisationserlebnisse als Symptome einer Psychose auftreten, etwa bei Schizophrenie.[9] Es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied zur DDS. Ein Beispiel: Jemand in einem psychotischen Zustand ist davon überzeugt, sein Körper sei von einem Fremden gesteuert. Bei Menschen mit DDS bleibt die Realitätsprüfung hingegen intakt: Es fühlt sich für sie nur so an, als ob sie selbst fremd seien.[10]
DDS ist ein eigenständiges Krankheitsbild
Kurzzeitige Depersonalisation oder Derealisation erleben viele Menschen einmal in ihrem Leben – etwa bei Übermüdung, nach Alkoholkonsum oder bei einem schockierenden Ereignis wie einem Unfall. Auch als Begleitsymptome anderer psychischer Störungen kommen Depersonalisation und Derealisation vor, etwa während einer Panikattacke.[11] Die DDS ist jedoch ein eigenständiges Krankheitsbild, das mit erheblichem Leidensdruck verbunden ist.
In den zwei gängigen Klassifikationssystemen für psychische Erkrankungen – dem ICD-10 der WHO und dem DSM-5 der American Psychiatric Association – wird die DDS ähnlich definiert (siehe Tab. 1). Ein Unterschied: Im ICD gehört das Krankheitsbild in die Rubrik „Andere neurotische Störungen“, während es im DSM-5 zu den dissoziativen Störungen zählt.[12]
| Diagnosekriterien nach ICD-10 (Kürzel: F48.1) | Diagnosekriterien nach DMS-5 (Kürzel: 300.6) |
|---|---|
A. Mindestens eines der beiden Kriterien muss erfüllt sein:
B. Zusätzlich müssen beide der folgenden Kriterien erfüllt sein:
| A. Andauernde oder wiederholte Erfahrung von Depersonalisation und/oder Derealisation:
C. Die Beschwerden verursachen in bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Bereichen. D. Die Störung ist nicht auf eine Substanz oder eine andere Erkrankung zurückzuführen. E. Die Störung wird nicht durch eine andere psychische Erkrankung besser erklärt (z.B. Schizophrenie, Panikstörung etc.) |
(Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Dilling (2015), S. 237-238; Falkai et al. (2018), S. 302-304)
Wie entsteht eine DDS?
Untersuchungen weisen darauf hin, dass ein ängstliches Temperament in Verbindung mit mangelnder emotionaler Unterstützung das Risiko für eine DDS erhöht. Studien zufolge zeichnen sich Betroffene durch ein niedriges Selbstwertgefühl, negative Beziehungserwartungen, soziale Ängste und Schamangst aus. Auch dysfunktionale Abwehrmechanismen wie Selbstentwertung, Verleugnung oder Isolierung spielen eine Rolle.[13] Genetische Ursachen wurden bislang nicht festgestellt.[14]
Als Auslöser für den Ausbruch der DDS gelten vor allem psychosoziale Überforderung und der Konsum illegaler Drogen. Auch stehen am Beginn oft depressive Episoden oder Panikattacken.[15] Viele Menschen mit DDS leiden zugleich an weiteren psychischen Erkrankungen wie etwa Depressionen und Angststörungen.[16]
Was hilft bei einer DDS?
Bislang gibt es kein Medikament, das zur Behandlung einer DDS zugelassen ist.[17] Auch wenn bislang randomisierte kontrollierte Studien fehlen, gilt die Psychotherapie als Mittel der Wahl. In der Regel handelt es sich um eine Langzeittherapie. Wichtig ist, den Patient*innen die Angst zu nehmen, „verrückt“ zu sein oder an einer organischen Erkrankung zu leiden. Durch Erlernen entsprechender Strategien soll zudem die Selbstwahrnehmung der Patient*innen verbessert werden, etwa mithilfe eines Symptomtagebuchs oder von Achtsamkeitsübungen.
Zur Psychotherapie gehört auch, die Lebensführung der Patient*innen zu beleuchten, denn bestimmte Faktoren können die Symptomatik verschlechtern. Welche das sind, ist individuell verschieden. Als häufige negative Einflüsse werden unter anderem Schlafmangel, Substanzmissbrauch oder exzessives Computerspielen beschrieben.[18]
Fazit
Die DDS findet bislang (zu) wenig Beachtung – und das, obwohl das Krankheitsbild nicht selten zu sein scheint und der Leidensdruck der Erkrankten hoch ist.
Erfreulicherweise gibt es seit 2014 eine Leitlinie, in welcher die wesentlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur DDS erfasst sind. Seit einigen Jahren können Betroffene eine Anlaufstelle aufsuchen: Die Uni Mainz bietet eine Spezialsprechstunde an. Neben einer umfangreichen Diagnostik können sich Erkrankte dort über Therapieoptionen beraten lassen.[19]
[1] Vgl. Johnson et al. (2006); vgl. Lee et al. (2012); vgl. Michal (2018), S. 47; vgl. Michal et al. (2014), S. 10.; Hinweis: die AWMF-Leitlinie ist abgelaufen und wird derzeit überarbeitet.
[2] Vgl. Michal (2018), S. 47-48.
[3] Vgl. Michal (2018), S. 14.
[4] Vgl. Dilling (2015), S. 237-238; vgl. Falkai et al. (2018), S. 302-303; vgl. Michal (2018), S. 19.
[5] Vgl. Dilling (2015), S. 237-238; vgl. Falkai et al. (2018), S. 302-303; vgl. Michal (2018), S. 15-21; vgl. Sierra/Berrios (2000).
[6] Vgl. Dilling (2015), S. 237-238; vgl. Falkai et al. (2018), S. 302-303; vgl. Michal (2018), S. 15-21.
[7] Vgl. Falkai et al. (2018), S. 303-304.
[8] Vgl. Michal et al. (2014), S. 11-12.
[9] Vgl. Clamor et al. (2020), S. 954.
[10] Vgl. Dilling (2015), S. 237-238; vgl. Falkai et al. (2018), S. 302-303; vgl. Michal et al. (2014), S. 14.
[11] Vgl. Michal (2018), S. 22; S. 47.
[12] Vgl. Dilling (2015), S. 237-238; vgl. Falkai et al. (2018), S. 302-303.
[13] Vgl. Lee et al. (2012); vgl. Michal et al. (2014), S. 18-20; vgl. Simeon et al. (2002).
[14] Vgl. Michal et al. (2014), S. 18.
[15] Vgl. Falkai et al. (2018), S. 302-304; vgl. Michal et al. (2014), S. 20; vgl. Simeon et al. (2003).
[16] Vgl. Michal et al. (2014), S. 11-12.
[17] Vgl. Michal et al. (2014), S. 22.
[18] Vgl. Michal et al. (2014), S. 25-26; S. 30; S. 34.
[19] Vgl. Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2021).
Literaturverzeichnis
Clamor, A./Frantz, I./Lincoln, T. M. (2020), Psychotische Störungen und Schizophrenie. In: Hoyer, J./Knappe, S. (Hrsg.), Klinische Psychologie & Psychotherapie, 3. Aufl., Berlin, Heidelberg, S. 947-1003.
Dilling, H. (Hrsg.) (2015), Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD–10 Kapitel V (F) klinisch–diagnostische Leitlinien, 10. Aufl., Bern.
Falkai, P./Wittchen, H.-U./Döpfner, M./Gaebel, W./Maier, W./Rief, W./Saß, H./Zaudig, M. (2018), Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5®.
Johnson, J. G./Cohen, P./Kasen, S./Brook, J. S. (2006), Dissociative disorders among adults in the community, impaired functioning, and axis I and II comorbidity, Journal of psychiatric research, 40. Jg., Nr. 2, S. 131-140.
Lee, W. E./Kwok, C. H. T./Hunter, E. C. M./Richards, M./David, A. S. (2012), Prevalence and childhood antecedents of depersonalization syndrome in a UK birth cohort, Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 47. Jg., Nr. 2, S. 253-261.
Michal, M. (2018), Depersonalisation und Derealisation. Die Entfremdung überwinden, 3. Aufl., Stuttgart.
Michal, M./Eckhardt-Henn, A./Heidenreich, T./Stiglmayr, C./van Tebartz Elst, L./Schmahl, C. (2014), Leitlinie Diagnostik und Behandlung des Depersonalisations-Derealisationssyndroms, in: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/051-030l_S2k_Depersonalisations_Derealisationssyndrom-abgelaufen_2014-09.pdf, abgerufen am 14.3.2022.
Sierra, M./Berrios, G. E. (2000), The Cambridge Depersonalisation Scale: a new instrument for the measurement of depersonalisation, Psychiatry Research, 93. Jg., Nr. 2, S. 153-164.
Simeon, D./Guralnik, O./Knutelska, M./Schmeidler, J. (2002), Personality factors associated with dissociation: temperament, defenses, and cognitive schemata, The American journal of psychiatry, 159. Jg., Nr. 3, S. 489-491.
Simeon, D./Knutelska, M./Nelson, D./Guralnik, O. (2003), Feeling unreal: a depersonalization disorder update of 117 cases, The Journal of clinical psychiatry, 64. Jg., Nr. 9, S. 990-997.
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2021), Sprechstunde Depersonalisation, in: https://www.unimedizin-mainz.de/psychosomatik/patienten/poliklinik-und-hochschulambulanzen/sprechstunde-depersonalisation.html, abgerufen am 20.3.2022.
Beitragsbild:
https://www.pexels.com/de-de/foto/monochrome-fotografie-eines-mannes-der-vor-spiegel-schaut-765217/
Credit: Min An